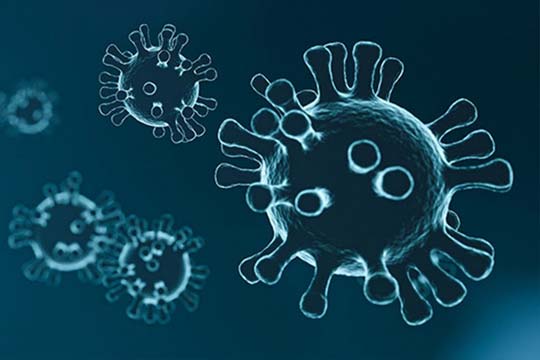Globale Lieferketten

©AdobeStock kamonrat
Die deutsche Wirtschaft ist bereits seit Jahren sehr aktiv bei der Wahrnehmung ihrer CSR- und Nachhaltigkeitsaktivitäten in globalen Lieferketten
Viele – vor allem größere – deutsche Unternehmen haben in den letzten Jahren eigene CSR-/Nachhaltigkeitsabteilungen eingerichtet. So arbeiten insbesondere bei großen Unternehmen immer mehr Mitarbeiter direkt im Bereich CSR/Nachhaltigkeit. Aber auch viele kleine und mittlere Unternehmen haben in den letzten Jahren Maßnahmen im Bereich CSR ergriffen. Im Rahmen ihrer CSR-/Nachhaltigkeitsstrategie haben viele Unternehmen auch konkrete Maßnahmen zur Umsetzung der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen getroffen.
Gesellschaftliches Engagement ist fester Bestandteil der gewachsenen deutschen Unternehmenskultur. Deutsche Unternehmen engagieren sich allein im sozialen Bereich jährlich mit 11,2 Mrd. €. Darüber hinaus bestehen eine Vielzahl von Initiativen auf internationaler und nationaler Ebene, um die Ideen von CSR und Nachhaltigkeit zu fördern, wie beispielsweise der UN Global Compact Netzwerk und Deutsches Global Compact Netzwerk, das Bündnis für nachhaltige Textilien, Together for Sustainability (TfS), Chemie³, Bettercoal usw.
Die deutschen Unternehmen genießen im Zuge ihres außenwirtschaftlichen Engagements einen sehr guten Ruf
Komplexität globaler Lieferketten anerkennen
„Globale Lieferketten sind komplex, vielfältig und fragmentiert. … Sie haben zum Wirtschaftswachstum, zur Schaffung von Arbeitsplätzen, zur Verringerung von Armut und zum Unternehmertum beigetragen und können einen Beitrag zum Übergang von der informellen zur formellen Wirtschaft leisten.“
(Quelle: Tripartistischen Entschließung der Internationalen Arbeitskonferenz (IAK) 2016 zu menschenwürdige Arbeit in globalen Lieferketten)